Die gegenwärtigen Dissonanzen zwischen Moskau und dem westlichen Bündnis wecken Sorgen wie seit Langem nicht mehr. Der Aufmarsch russischer Truppen im Zuge der Grenze zur Ukraine, dem weder reine Übungsnotwendigkeiten noch wirkliche Bedrohungen zugrunde liegen, führt mehr und mehr zu einer grundsätzlichen Auseinandersetzung über die Sicherheitsordnung in und für Europa. Das allein wäre nicht weiter problematisch – im Gegenteil, es ist eigentlich überfällig. Aber die Lage droht sich nunmehr so zu verhärten, dass eine gewollte oder ungewollte Eskalation bis hin zum Waffeneinsatz nicht mehr völlig ausgeschlossen werden kann. Das Ergebnis wäre für alle Seiten ein Desaster, so viel ist gewiss. Es gäbe dann nur Verlierer – außer China.
Auf westlicher Seite besteht kein Mangel an Ratschlägen, wie in dieser schwierigen Situation zu handeln sei. Die Bandbreite reicht von so fundamentalem wie naivem Appeasement gegenüber Putins Rochaden bis hin zu demonstrativem Zeigen der eigenen Folterinstrumente militärischer oder zumindest wirtschaftlicher Art. Einig sind sich aber alle: Jede weitere Eskalation sollte unbedingt vermieden werden. Es gibt keine Alternative zu ernsthaften Bemühungen um Dialog und Entspannung. Die Frage dreht nur um das „wie?“.
Der russische Präsident Putin hat nun den Ball aufgenommen und auf verschiedenen diplomatischen Kanälen (sowohl gegenüber den USA als auch gegenüber der Nato – mit jeweils unterschiedlichen Tonlagen) quasi in Diktatform vorgegeben, wie sich Russland die Grundpfeiler einer neuen Sicherheitsarchitektur für Europa vorstellt. Sein Versuch zur Steilvorlage ist in der Substanz ebenso atemberaubend wie im Tempo, in der ihr nachgejagt werden soll. Im Ergebnis lässt sich die Position Moskaus plakativ so zusammenfassen: Die Uhren Europas sollen mehr oder weniger auf den Stand am Ende des Ost-West-Konflikts zurückgedreht werden. Ein Reset also, der eine russische Großmachtposition wiederherstellt und zementiert – und sei dies auf Kosten jeglicher Souveränität von bis dahin abhängigen Drittstaaten oder Ethnien.
Der Forderungskatalog Putins umfasst dabei eine ganze Reihe von Punkten, über welche wohl niemand im Westen auch nur zu sprechen bereit ist: Die USA sollen sich jeder weiteren Ausdehnung der Nato nach Osten enthalten und mit ehemaligen Teilstaaten der Sowjetunion keine militärische Zusammenarbeit pflegen oder gar dort eigene Stützpunkte bzw. Infrastrukturen aufbauen. Raketen, Kriegsschiffe und strategische Bomber sollen sowohl auf russischer wie auf amerikanischer Seite auf das eigene Territorium begrenzt bleiben – ungeachtet der geostrategisch völlig unterschiedlichen Ausgangslage mit Blick auf Europa. Gleiches gilt auf nuklearer Ebene für taktische US-Sprengköpfe und Mittelstreckenraketen, wobei hier nach russischer Lesart etwa die in Kaliningrad stationierten nuklearen Mittel ebenso wie die im Militärbezirk West bereitgehaltenen SSC-8 nicht betroffen sind. Ferner – und hier wird es dann besonders bizarr – soll die Nato jede Stationierung von Truppen etwa im Baltikum oder in Polen einstellen und im Grundsatz alle dortigen Anstrengungen zur Bündnisverteidigung rückgängig machen. Usw.
Putins Liste verschlägt den Atem – und dummerweise spricht manches dafür, dass genau dies gewollt ist. Auch auf russischer Seite weiß man ziemlich gut, wie wenig eine rigide Forderungsliste von solcher Qualität zur Deeskalation geeignet ist. Natürlich stehen am Beginn von Verhandlungen immer divergierende Vorschläge. Natürlich gibt niemand gleich zu Beginn wertvollen Boden preis und lässt sich in die Karten schauen. Natürlich versucht man mit mehr oder weniger guten Tricks die Gegenseite auszutesten, bevor man das eigene Blatt offenlegt. Aber wer von vorneherein und ganz bewusst so maßlos überzieht, schafft alles andere als das Vertrauen, das für spätere Kompromisse unabdingbar ist. Die russische Führung weiß das sehr wohl, und trotzdem wählt sie den Weg der Provokation.
Damit stellt sich die entscheidende Frage nach dem „warum?“. Die gefährlichste These lautet dabei: Dieser Forderungskatalog aus Moskauer Sicht erfüllt nur einen einzigen Zweck – den der gewollt herbeigeführten Ablehnung mit dem Ergebnis, damit die Schuld für eine weitere Eskalation der westlichen Seite zuschieben zu können. Ist der russische diplomatische Vorstoß also der propagandistische Auftakt zu einer bewusst geplanten Lageverschärfung mit Blick auf die Ukraine? Ist er der diplomatische Startschuss zu einem (weiteren) Überfall auf Teile der ehemaligen Sowjetunion, die strategisch für Russland interessant sind? Ist er der Versuch, Europa und den USA gegenüber zu verstehen zu geben, wie wenig wirtschaftliche Sanktionen beeindrucken und wie schwer das glorreiche russische Erbe wiegt? Oder blufft Putin nur und hofft schlichtweg auf eine Uneinigkeit innerhalb der Nato und auf die strategische Schwäche der USA in einer zunehmend diffusen globalen Lage? Welche Karten hält er eigentlich: Nieten oder Trümpfe?
Damit stellt sich wieder einmal die klassische Herausforderung in außenpolitischen Kontroversen: Die der nüchternen Beurteilung der gegnerischen Lage. Im Zentrum steht die Frage, was der Gegner will, was er kann und welche realistischen Handlungsoptionen er besitzt. Erst wenn das hinreichend analysiert und beantwortet ist, macht die Entwicklung eigener strategischer Konzepte und Entscheidungen Sinn.
Zusammengefasst drängen sich also folgende Fragen auf:
- Welches sind die langfristigen Ambitionen, welches die mittelfristigen Absichten, welches die kurzfristigen Pläne Putins?
- Welche Chancen besitzt Russland, um seine Agenda durchzusetzen? Auf welche Optionen Putins müssen sich Nato und EU besonders einstellen?
- Wie sollte man den russischen Zumutungen begegnen – ohne zu eskalieren, aber auch ohne die eigenen Grundpositionen zu untergraben?
Diskutieren Sie mit! Jede Meinung ist erwünscht. Sie müssen sich nur an die rechtlichen Bestimmungen und an das hier gestellte Thema halten.

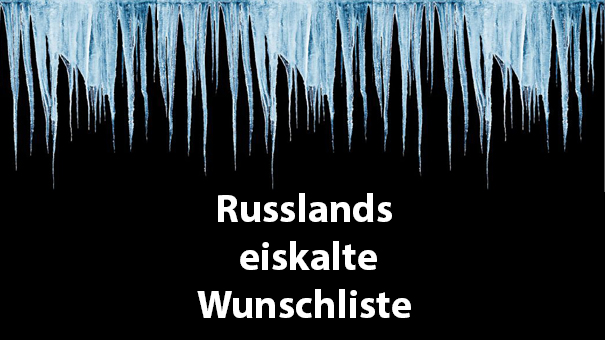

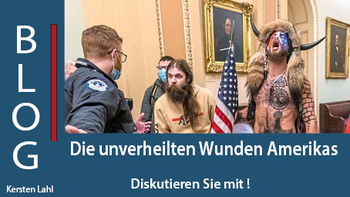






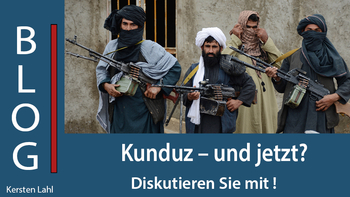

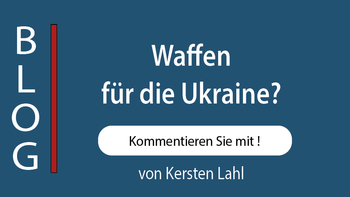
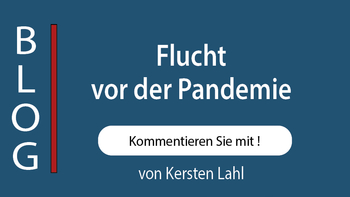
Kommentare (3)
Die Nato reagiert derzeit offenbar mit einer erhöhten Einsatzbereitschaft unter anderem ihrer Response Force NRF zum Schutz der Bündnispartner im Osten Europas, zeigt sich aber nach den Worten Stoltenbergs weiterhin offen für Dialog mit Russland. Mit Appeasement allerdings nicht zu verwechseln. Es bleibt also auch über Weihnachten und den Jahreswechsel hinweg spannend.
- Beispiel 1: Moskau habe mit Blick auf die Ukraine einen Anspruch auf die „historischen russischen Territorien mit der Bevölkerung des historischen Russlands“ (in der heutigen SZ so zitiert). Da darf man gern mal einen Faktencheck anstellen und das Budapester Moratorium von 1994 (explizit auch von Russland unterzeichnet) betrachten. Dort verpflichten sich die Signatarstaaten ausdrücklich, die Souveränität etwa der Ukraine zu achten. (Dies übrigens als Gegenleistung dafür, dass die betreffenden ehemaligen Sowjetstaaten ihre Nuklearwaffen an Russland übergeben.)
- Beispiel 2: Putin erklärt, im Fall eines Scheiterns der Verhandlungen um die von ihm ultimativ geforderten Sicherheitsgarantien (s. Ausgangsartikel oben) käme es darauf an, was die russischen Militärexperten ihrem Präsidenten unterbreiten. Militärische Ratschläge werden also zum alles dominierenden Gradmesser – ohne dass Russland selbst von irgendeiner Seite militärisch konkret bedroht wird. Das erinnert dann durchaus an die These von Clausewitz, Krieg sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.
Was kommt da wohl noch? Dient das alles wirklich der Deeskalation und Verständigungsbereitschaft? Oder setzt Moskau auf eine Führungs- und Entscheidungsschwäche von Nato und EU, um seine eigene Interessen notfalls gewaltsam durchzupauken und sich dabei vorab ein Narrativ der Legalität zu basteln? Ist das vielleicht aber auch nur eine brandgefährliche Fehlkalkulation Putins?
In vielen, klugen Artikeln wurde seit dem 24.02.2022 über die falschen Einschätzungen Russlands und seiner Politik (Tschetschenien, Georgien, Syrien, Anschlag auf Herrn Skripal, Tiergartenmord...) berichtet. Eine grundsätzliche Änderung der westlichen, respektive deutschen Einschätzung der russischen, imperialen Eroberungspolitik und seiner Kompromisslosigkeit ist allerdings nicht eingetreten. Das russ. Narrativ der NATO-Osterweiterung, die angebliche Einkreisung Russlands durch den Westen, den Schutz russisch-stämmiger Bürger in der Ostukraine wird bei uns immer wieder als mögliche Begründung russischen Handelns angeführt. Hier funktioniert leider die russische Propaganda.
Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass der Zusammenbruch der UdSSR und des WP von Russland als "größte Katastrophe seit dem II.Weltkrieg"(Putin) angesehen wird. Und mit der Verbesserung der wirtschaftlichen und militärischen Macht Russlands (ab ca.2005) nun die Geschichte revidiert werden soll. Imperialistische Ausdehnung der Einflusszone Russlands wie vor 1989. Da ist der Angriff auf die Ukraine sicher nur der Anfang, der erfreulicherweise recht missglückt ist und auch die Schwächen und Fehleinschätzungen Russlands offenbart hat.
Die EU und die NATO-Staaten sollten sich auf eine andauernde, variantenreiche und aggressive russische Bedrohung des Friedens und der Freiheit in Europa einstellen und alle notwendigen Maßnahmen zum eigenen Schutz und zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit ergreifen.