Der Einsatz in Afghanistan ist Vergangenheit. Nun sind die Augen des europäischen militärischen Krisenmanagements noch mehr als bisher auf Mali gerichtet. Schon seit einiger Zeit gilt der Einsatz in diesem Land als der gefährlichste aller aktuellen Missionen.
Beim Blick auf dieses krisengeschüttelte Land in der Sahel-Zone eröffnen sich beunruhigende Parallelen zum Hindukusch. Auch hier versuchen Europa und die Vereinten Nationen mittels militärischer Ausbildungsunterstützung und weiteren Mandate eine gewisse Stabilisierung zu fördern – zusätzlich zu rein französischen, vergleichsweise sehr robusten Anstrengungen. Dabei geht es keineswegs nur um Mali und seine Bevölkerung selbst. Vielmehr gilt es, einer weiteren Ausbreitung des islamistischen Terrorismus, dessen Brutstätten in fragilen Staaten beste Bedingungen finden und von dort aus ganze Regionen destabilisieren und die internationale Gemeinschaft bedrohen, einen Riegel vorzuschieben. Damit sind dezidiert auch unsere eigenen sicherheitspolitischen Interessen berührt.
Ein wirklicher Erfolg dieses Bemühens ist bisher allerdings schwer zu erkennen. Auch in Mali scheint Ähnliches zu gelten wie in Afghanistan: Westliche Ambitionen, in Krisenregionen anderer Kontinente ein friedliches Zusammenleben zu fördern oder zu erzwingen, stoßen erkennbar an Grenzen. Eine fremde Kultur mit uns fremden Werten, eine undurchschaubare Gemengelage diverser Ethnien, Milizen und Interessen sowie eine qualitativ kaum genügende Regierungsführung vor Ort schaffen ein Umfeld, in dem nachhaltige Fortschritte extrem schwer erreichbar sind. Und wenn dann auch noch in dem Land das von uns protegierte und seit Jahren ausgebildete Militär wiederholt glaubt putschen zu müssen, dann stellt sich schon so etwas wie die Sinnfrage.
Auf der anderen Seite wissen oder zumindest ahnen wir: Wenn wir Europäer uns angesichts einer als recht deprimierend empfundenen Lage zurückziehen, entsteht mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut ein Vakuum mit alles andere als wünschenswerten Folgen. So provokativ es auch klingen mag: Unsere Sicherheit wird letztlich eben auch in diesen fragilen Regionen verteidigt, und Kapitulation dient diesem Ziel eher weniger.
Das offenkundige Dilemma droht sich aktuell weiter zuzuspitzen. Aus recht undurchschaubaren Gründen – es wird der angebliche Bedarf Malis nach einer Diversifizierung vorgeschoben – denken die aktuellen Machthaber in Bamako über eine Zusammenarbeit mit rund 1.000 Söldnern einer russischen Söldnertruppe mit dem so deutschklingenden Namen „Wagner“ nach. Der Leumund dieser Organisation ist – vorsichtig ausgedrückt – nicht der beste, und die vermuteten direkten Verbindungen in den Kreml hinein verunsichern zusätzlich. Eine strategische oder operative Zusammenarbeit mit den europäischen Truppen vor Ort scheint völlig undenkbar, aber auch ein paralleles Wirken kann man sich in der Praxis und unter geopolitischen Aspekten kaum vorstellen.
Und genau deshalb ist man vor allem in Paris und in Berlin nicht nur irritiert, sondern prüft harte Konsequenzen, falls die Machthaber in Bamako an ihren merkwürdigen Plänen festhalten. Die weitere Zukunft der – ohnehin nicht übermäßig geliebten – militärischen Krisenmissionen in Mali hängt damit am seidenen Faden. Es gilt, wie so oft in sicherheitspolitischen Fragen, zwischen zwei oder mehreren Alternativen diejenige auszuwählen, die am wenigsten schädlich ist.

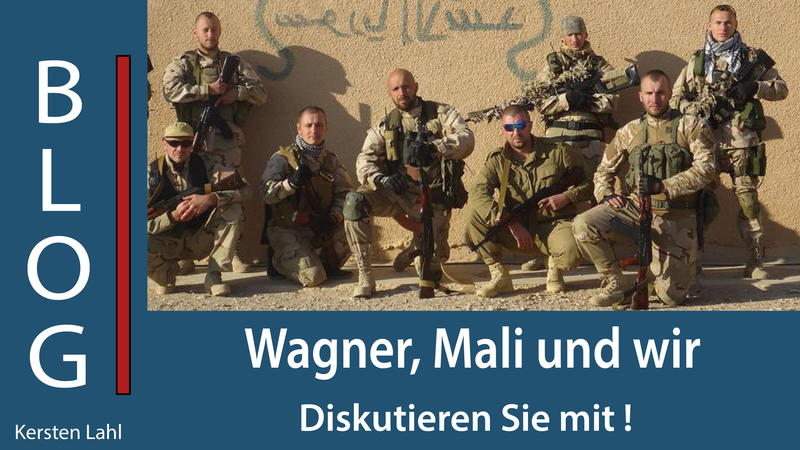

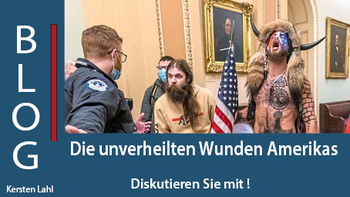






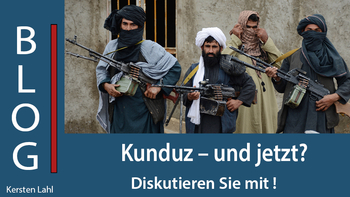

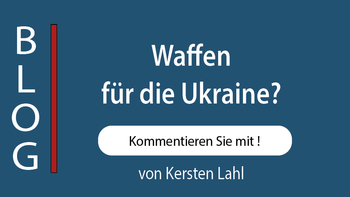
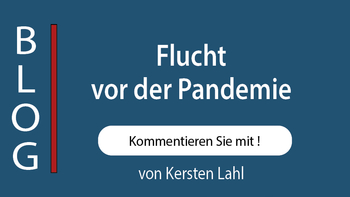
Kommentare (1)
Ein verfassungsrechtlich gebotenes Parlamentsmandat unter Einschließung der skizzierten Neuausrichtung lässt sich allerdings im Kontext der anstehenden Bundestagswahl als äußerst unrealistisch einstufen, da der (politische) Wille für ein realistisches Fazit aus dem Afghanistan Einsatz gegenwärtig nicht mehrheitsfähig ist: Kurzweilige, dafür aber vehemente Interventionen zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus sind nachhaltiger, verlustärmer und zweckdienlicher als auf Jahre ausgerichtete Operationen mit einem erzieherischen Charakter.