Das altbekannte Narrativ macht wieder die Runde: In Krisen wird fast reflexartig der Europäischen Union vorgeworfen, sie versage, besitze keinen Mehrwert und sei ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Ja mehr noch, sie lasse ihre in Not geratenen Mitglieder im Stich. Es ist dann also die hohe Zeit der Skeptiker. Umso lauter ruft man dann nach dem Nationalstaat – den man vorher freilich davor bewahrt hat, zur Krisenbeherrschung erforderliche Mittel und Kompetenzen an die Gemeinschaft abzugeben. Das erinnert mitunter schon an das, was man „sich selbst erfüllende Prophezeiung“ nennen könnte.
In der aktuellen Corona-Krise ist das nicht anders. Denn auch in der engeren Gesundheitsvorsorge kann auf europäischer Ebene nichts oder nur vergleichsweise wenig entschieden werden. Das ist vielmehr – aus keineswegs falschen Gründen – eine nationale, regionale oder lokale Aufgabe, je nach Verfassung der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU.
Dennoch ist die EU keineswegs machtlos, wenn es um die Krisenbewältigung im weiteren Sinne geht. Sie kann – wenn das alle wollen – einen Rahmen schaffen, der eine gegenseitige Unterstützung aller Mitgliedsstaaten schafft und erleichtert. Das gilt vor allem mit Blick auf eines der traditionellen Kernanliegen der EU, das auf eine gemeinsame Wirtschaftspolitik zum erhofften Nutzen aller zielt. Wohl selten zuvor war das so wichtig wie jetzt. Und nur selten zuvor wird so heftig darüber gestritten, was das eigentlich im Kern bedeutet.
In dieser unserer fünften Diskussionsrunde zur Corona-Krise soll analysiert und debattiert werden, ob die Europäische Union in den derzeit so schwierigen Zeiten den hohen Erwartungen gerecht wird und gerecht werden kann. Mögliche Stichworte liegen auf der Hand: Etwa die gefühlte Solidarität der europäischen Partner untereinander, die unmittelbaren Folgen des Brexit in der aktuellen Krise, mit den EU-Richtlinien unvereinbare rechtstaatliche Turbulenzen in einzelnen Mitgliedsstaaten, Nutzen und Risiken offener oder geschlossener Grenzen innerhalb des Schengen-Raums, die Zukunft der erstrebten Freizügigkeit von Menschen und Gütern, bis hin zur heftig umstrittenen Frage von Euro-Bonds u.v.a.m..
Kurz gefasst: Wohin driften die EU und die europäische Idee im Zuge der Corona-Krise und danach? Wächst Europa in der Not zusammen, oder fällt es eher auseinander? Steht es also tatsächlich in einer Überlebensfrage, wie renommierte Außenpolitiker wie Wolfgang Ischinger es formulieren? Droht es de facto obsolet und damit im globalen Kontext irrelevant zu werden, oder wacht es auf und besinnt sich auf die Tatsache, dass man nur gemeinsam stark sein kann? Was bedeuten beide Varianten in sicherheitspolitischer Sicht, dies mit Blick auf rivalisierende Mächte und erwartbare Risiken auch über Europa hinaus? Und vor allem: Was ist zu tun und wie ist das Getane den Menschen gegenüber zu kommunizieren, um das Eintreten noch schlimmerer Szenarien zu verhindern?
Nutzungsrichtlinien für den GSP-Blog


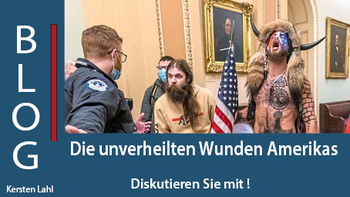






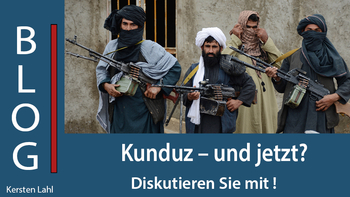

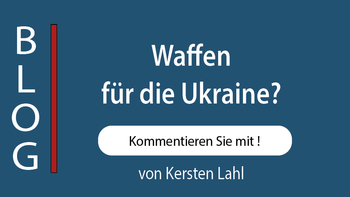
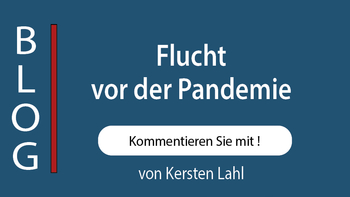
Kommentare (12)
Fußnote: Ein wichtiges, aber oft übersehenes Teilthema ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, also ganz konkret in Grenzregionen, die u. a. in Gesundheitsfragen schon jetzt eine wichtige Rolle spielt - wie bei allen Problemen bspw. der Fall Elsass zeigt. Dort wird die Übernahme von Intensivpatienten nach Deutschland - gerne als pure Symbolpolitik und "Tropfen auf den heißen Stein belächtelt - jedenfalls sehr genau zur Kenntnis genommen.
Das Prinzip scheint zu sein: Wir helfen einander - solange wir selber dadurch keine großen Kosten tragen müssen. Diese Erfahrung ist sehr wichtig für die zukünftige Ausgestaltung der EU-Politik. Denn die Corona-Krise wird die Mitgliedstaaten (die nationalen Regierungen aber vor allem die Gesellschaften) hoffentlich darüber nachdenken lassen, warum ein gemeinsames Europa notwendig ist. Demnach glaube ich, dass die Corona-Krise einen positiven Impuls für die zukünftige globale Zusammenarbeit geben könnte.
So erkenne ich derzeit schon eine sehr umtriebige Kommission im Krisenmodus, die alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert (vgl. bspw. Pressemitteilung 02.04). Alles darüber hinaus, sowie auch darunter, obliegt nun zunächst den Regierungschefs. Im Rahmen der Subsidiarität finde ich die Rollen derzeit gut ausgefüllt. Fraglich ist, warum nicht zuerst ein klares politisches Bekenntnis der Solidarität gesendet wird, bevor die Bevölkerung in dieser Krisenphase mit technischen Fragen des Corona-Bond vs. ESM behelligt wird.
Aus sicherheitspolitischer Sicht lohnt meines Erachtens ein frühzeitiger Blick auf die EU-Aussenperspektive. Zum einen wäre hier jetzt auch uneingeschränkte, konkrete Solidarität gegenüber dem wichtigsten europ. EU-Verbündeten auch nach dessen Brexit angezeigt. Ein „Da sehen sie was sie davon haben“ ist moralisch wie strategisch unangebracht.
Zum anderen ist doch absehbar, welche Herausforderungen der afrikanische Kontinent - wirtschaftlich wie migrationspolitisch - für Europa bringen wird. Aus der Ebola-Krise wurden seinerzeit Lehren gezogen, die nun umzusetzen wären. Sicher nicht ohne Grund wird das deutsche Engagement zur Stärkung afrikanischer Gesundheitssysteme maßgeblich auch im Zuge präventiver Biosicherheitspolitik betrieben. Bislang (meines Wissens auslaufend) lief dies unter dem Dach der G7, von denen ich mir in dieser Weltlage wenig Unterstützung in der Sache verspreche - ausgenommen vmtl. China - dem strategischen Rivalen der EU in Afrika. Hierauf wäre nun strategisches Augenmerk der EU angebracht. Sicher wäre jeder EU Staat, insbesondere die Corona-gescholtenen Mittelmeeranrainer, in dieser Phase froh über frühzeitig koordiniertes Vorgehen.
Für mich kommt die EU wieder dann verstärkt ins Spiel, wenn aus der gesundheitspolitischen Krise eine wirtschaftspolitische Krise wird. Aber natürlich wird auch hier die EU von der Solidarität ihrer Mitglieder abhängig sein.
Insofern halte ich es für essentiell wichtig, wenn der deutsche Außen- und der Finanzminister Hilfsbereitschaft für die schwächeren EU-Mitglieder signalisieren, aber bei Solidaritätsbekundungen allein darf es nicht bleiben. Ob Taten innerhalb des ESM oder der Euro-Bonds folgen, sei hier dahingestellt – mir scheint, dass beide Maßnahmen nur der Anfang einer längeren Reihe von Investitionsmaßnahmen sein werden, um die langfristigen Folgen in der EU abfedern zu können. Von der Leyen als zentraler Teil von ‚der EU' stößt mit ihrem „Marshall-Plan für Europa“ dahingehend auch ins richtige Horn.
Sollten die Umsetzungen aber nicht zielführend sein und innerhalb der EU der Eindruck entstehen, dass es keine wirtschaftspolitische Solidarität gibt, wird auch eine engere sicherheitspolitische Zusammenarbeit in Zukunft illusorisch.
Mit Blick auf die internationalen Entwicklungen, die von keinem Mitglied der EU alleine mitgestaltet werden können, dürfen wir uns das nicht erlauben.
Die EU braucht nun einmal mehr ein solidarisches Führungsangebot. Die diskutierten „Coronabonds“ können dabei ein wichtiger Baustein sein, damit aus der sanitären Krise nicht anschließend eine Finanzkrise 2.0 wird. Deutschland und Frankreich sind hier klassisch unterschiedlicher Auffassung und sollten einen Kompromiss aus der Konfliktlinie innerhalb der EU um die gemeinsamen Anleihen erarbeiten. Vor allem die nordeuropäischen Mitgliedstaaten müssen hierzu wohl bereit sein alte Grundüberzeugungen aufzugeben, um das wichtige Signal des Zusammenhalts zu demonstrieren. Die weiter fallende Zustimmung der Bevölkerung in Italien zur EU (nur noch 30 Prozent) verdeutlicht, dass auch der symbolische Wert einer solchen Maßnahme nicht unterschätzt werden sollte und ohne ein solidarisches Handeln ein weiteres Auseinanderfallen der EU droht!
Zugleich fällt aber auf: Im Norden Italiens und insbesondere der Lombardei wurde mit der Lega Nord eine Bewegung geboren, die in ihrem rechtspopulistischen Kern ihrerseits auf Abgrenzung (zunächst von der Mitte und dem Süden Italiens) zielte und sich später auch immer mehr als europaskeptisch entpuppte. Das spezielle Europa der Regionen, von dem man träumt, ist bei genauem Hinschauen eher keines der hilfsbereiten Unterstützung Schwächerer durch Stärkere und damit des sozialen, humanitären Ausgleichs. Ich weiß, die Wirklichkeit ist sehr viel komplexer, aber ich glaube nicht, dass ich Herrn Salvini und anderen mit dieser Einschätzung allzu viel Unrecht tue.
Anspruch und berechtigte Hoffnung auf Hilfe durch die EU lassen sich umgekehrt aber umso besser realisieren, je mehr sie gestärkt wird. Und Kritik an Europa hat immer dann einen merkwürdigen Beigeschmack, wenn sie aus dem Lager derjenigen kommt, die eine Bündelung europäischer Kräfte – was dann freilich auch immer auch eine Übernahme sozialer und ökonomischer Aufgaben bedeutet, mitunter auch zulasten nationalstaatlicher Eigeninteressen – so weit wie nur möglich verhindern wollen.
In diesem Zusammenhang eine Anmerkung: Die Behandlung italienischer und französischer Patienten in deutschen Krankenhäusern hat nichts mit Solidarität zu tun. Auch hier geht es um nationalen Eigennutz. Mit Beginn der Corona-Krise waren die Krankenhäuser gehalten, alle nicht lebensnotwendigen OPs zu verschieben und ihre Intensiv-Kapazitäten hochzufahren. Ersteres führt zu leeren OP-Sälen, letzteres geht zu Lasten der „normalen“ Kapazitäten. Hinzu kommt oft die Angst der Normalpatienten, sich im Krankenhaus mit dem Virus anzustecken. Unter dem Strich bedeutet das für die Krankenhäuser, die in unserem Gesundheitssystem ausschließlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden und sich „rechnen“ müssen, einen Umsatzverfall. Denn die deutschen Corona-Patienten kommen noch nicht in „ausreichender“ Anzahl. Zwar erhält jedes Krankenhaus pro leerstehendem Intensivbett einen Pauschbetrag. Doch ist er bei weitem nicht ausreichend, die Verluste aufzufangen. Da kommen dann die italienischen und französischen Patienten gerade recht.
Wem diese Betrachtung zynisch erscheinen mag, der liegt m.E. richtig. Dennoch: Das ist die Wirklichkeit, die Krankenhausverwaltungen inzwischen so weit bringt, Kurzarbeitspläne für ihr Personal zu prüfen - eine fatale Entwicklung, die es zeitnah zu überdenken gilt. Aber zurück zum Thema und der nächsten Fehlentwicklung:
Wir brauchen unter den europäischen Nationalstaaten mehr Solidarität und mag sie auch aus gemeinsamen Interessen geboren sein. Übrigens meine ich mit europäisch nicht nur EU-europäisch. Wir sind als Kontinent zu klein, um uns auch noch divergierende Partikularinteressen leisten zu können - nicht nur im Gesundheitswesen!
Es ist zwar nicht einfach, ohne originäre Zuständigkeit in der Sache, ein gemeinsames abgestimmtes Handeln auf den Weg zu bringen. Abgesehen von einzelnen lobenswerten Hilfeleistungen in unseren Kliniken (auch in anderen Nachbarländern) "als das Kind schon im Brunnen lag", ist auf der EU-Ebene wenig zur Krisenbewältigung passiert. Das Einzige, was jetzt an Gemeinsamkeit festzustellen ist, ist der Ruf, die auf die Krise folgenden Auswirkungen in finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht europäisch zu "vergemeinschaften".
Lange vor einer Schließung der Außengrenzen hätte sich ein Gremium wie z.B. ein "Euroäischer Sicherheitsrat" der Thematik annehmen und Handlungsempfehlungen verabschieden sollen.
Aber nach der Krise ist vor der Krise. Nur gemeinsam sind solche und ähnliche Situationen zu meistern. Darauf sollten wir uns besinnen, als hinterher die "pots cassés" gemeinsam zu bezahlen.
Und die EU? Hält ihr Parlament schwach, die Öffentlichkeit stumm und die Macht draußen. Sie liegt in den Händen des Rates und der setzt sich der Natur der Sache nach aus den Nationalstaaten zusammen. Jeder kocht seine eigene Suppe.
Tiefpunkt aus Sicht der Demokratietheorie, die die Legitimität der politischen Ordnung der EU beschreibt, war sicher die Vergabe der Spitzenposten. Ist doch das Ratsprinzip so unpraktisch, wie wenn in Deutschland der Bundesrat über die Politik entscheidet. Man stelle sich – eine sicherheitspolitische Brille - das Gezerre vor, würde der Bundesrat über die Auslandseinsätze der Bundeswehr entscheiden dürfen. Ich meine so abwegig ist das eigentlich gar nicht. Einerseits gehen ja Soldaten aus Bayern, Niedersachsen und allen anderen Bundesländern da hin; gewichtiger andererseits: Es geht um polizeiartige Einsätze. Und das ist Ländersache.
Kurzum, der Tiger Europa wird erst dann seine Zähne ausgehändigt bekommen, wenn die Nationalstaaten dies wollen. Und das geht nur über das Parlament; Europa braucht ein parlamentarisches Regierungssystem. Das ist schließlich der segensreiche Konkordanzmechanismus, der sogar Deutschland – aber erst mit dem politischen System des Grundgesetzes – zu einem Erfolgsmodell gemacht hat. Es ist das Handlungsschema, das alle Gruppierungen am Kuchen der Macht beteiligt; jeder kann mitreden, keiner wird ausgeschlossen. Wer es schafft Gehör zu finden, zeigt sich ganz von allein. Kurz gesagt: Parlamentarische Regierungsweise ist Kochkunst vom Feinsten. Die Chance dazu haben wir erst einmal verspielt. Aber das ist ja auch praktisch für die derzeitige Situation: Wenigstens als Sündenbock fällt die EU vorläufig nicht aus!