Der Konflikt zwischen den USA und Iran wird immer bizarrer. Jedenfalls fällt es nicht leicht, rationale Interessen hinter den immer aggressiveren Worten und Taten beider Seiten zu entdecken. Die jüngste Eskalation mit der gezielten Tötung eines hochrangigen Generals Irans wirft tiefe Fragen auf – auch jenseits der offenkundigen Tatsache, dass es sich bei dem Betroffenen um eine zentrale Figur in der iranischen Strategie der Destabilisierung der Region und der Verbreitung von Terrorismus gehandelt hat.
Man fragt sich ernsthaft, welche Ziele – inzwischen muss man eigentlich von „Kriegszielen“ sprechen – alle beteiligten Seiten verfolgen. Auf iranischer Seite lässt sich ja durchaus das rationale Interesse erkennen, die regionale Vorherrschaft in der Levante – mit in keiner Weise tolerierbaren Mitteln – zu erringen. Die Zeit dafür ist günstig, denn die Instabilität der ganzen Region im Zuge der Turbulenzen des Arabischen Frühlings schafft Optionen einer grundlegenden Kräfteverschiebung. Bis heute lässt sich feststellen: Der Iran gehört bisher und zumindest kurzfristig zu den geopolitischen Gewinnern dieser Entwicklung, trotz seiner unverkennbaren inneren Probleme und der massiven Schwächung seiner Wirtschaft.
Was aber ist die vermutliche Ratio der USA für die jüngste und bewusst herbeigeführte Eskalation, die zweifelsfrei das Risiko eines größeren Krieges dramatisch erhöht hat? Die Begründung eines tödlichen Drohnenangriffs zu präventiven und damit rein defensiven Zwecken überzeugt rechtlich nicht unbedingt. Zumindest ist ein entsprechender Nachweis schwer zu führen. Ähnliche Zweifel gelten für das Ziel, die US-Aktion würde der „Abschreckung“ dienen. Das scheint eher naiv. Denn wer glaubt schon, der Iran würde gerade jetzt klein beigeben und damit seine regionalen Ambitionen de facto gefährden oder etwa seine nuklearen Anstrengungen herunterfahren? Nein, eine iranische Antwort dürfte zwar zunächst auf sich warten lassen und sich auf das beschränken, was der Iran kann: nämlich asymmetrisch gesetzte, sorgsam kalkulierte, aber dafür umso schmerzhaftere Nadelstiche unterhalb der Grenze einer offiziellen Kriegserklärung. Aber diese Ungewissheit über Art und Zeit einer Antwort ist ja das Mittel, gegen das hochtechnisierte Länder mit ihren eigentlich weit überlegenen Armeen bisher keine überzeugende Antwort kennen. Niemand möge auch glauben, der Iran habe nach dem Drohnenangriff nun keine strategischen Köpfe mehr, die das planen können – vielmehr muss man nach allen vergleichbaren Erfahrungen damit rechnen, dass sich Nachfolger in Krisenlagen meist noch radikaler zeigen. Und schließlich: Wenn es tatsächlich – gewollt oder ungewollt – zum großen und dann kaum noch begrenzbaren Krieg kommen sollte, dann gibt es für die USA eher wenig zu gewinnen im Vergleich zu den enormen Risiken. Die westliche und vor allem amerikanische Zukunft in fast der ganzen Region wäre wohl auf lange Sicht verspielt. Als Nutznießer freuen sich dann eher Russland und China – und vermutlich im Windschatten der Turbulenzen auch der IS.
Unter dem Strich bleibt damit unklar, warum Präsident Trump sich in eine so brandgefährliche Lage begibt. Ist das wirklich kühl kalkuliert und klug, wenn man vom Ende her denkt? Man fragt sich zudem, warum er als Anführer der westlichen Welt, in der global gültige Werte doch so groß geschrieben sind, ohne Mandat der Völkergemeinschaft Maßnahmen wie die gezielte Tötung von Regierungsangehörigen eines anderen Staates anordnet und diese auch offen vertritt, als sei dies völlig normal. Auch seine jüngste Drohung der 52 Ziele mit dem Zusatz, es befänden sich auch „kulturell“ bedeutsame darunter, irritiert in diesem Zusammenhang. Mit notwendiger Selbstverteidigung hat eine bewusste Zerstörung von Kulturgütern jedenfalls wenig zu tun. Viel eher ist dies ein weiterer Schritt in eine zwischenstaatliche Verrohung und in eine Relativierung internationalen Rechts. Eine Ordnung schützt man nicht, indem man sie untergräbt.
Insgesamt wirft das alles Rätsel auf – gerade auch, wenn man einem realpolitischen Ansatz folgt. Vielleicht muss man bei einer Motiverforschung daher die Perspektive radikal ändern – und zwar weg von der amerikanischen Außen- und hin zur Innenpolitik. Das Jahr der Präsidentschaftswahlen in den USA hat begonnen, und man darf getrost annehmen, dass Donald Trump nichts mehr interessiert als sein persönlicher Erfolg dabei.
Nun könnte man argumentieren: Ein gefährlich zugespitzter Konflikt mit dem Iran untergräbt sein Versprechen, Amerika aus militärischen Konfrontationen mehr und mehr herauszuhalten. Genau das wird man ihm auch vorwerfen. Aber auf der anderen Seite sind die innenpolitischen Vorteile extremer äußerer Spannungen in Zeiten einer Wahl auch nicht von der Hand zu weisen: Trump kann sich als robuster Vertreter amerikanischer Interessen in der Welt zeigen. Er wirkt wie jemand, der standhaft bleibt, die Muskeln spielen lässt und nicht klein beigibt. America first aus der Sicht seiner engsten Anhängerschaft eben. Zudem lenkt er von dem ihm unangenehmen Impeachment-Verfahren ab. Und: Sollte eine größere Antwort Teherans ausbleiben, wäre seine Abschreckungsthese bestätigt. Das würde ihm also nützen. Eskaliert aber umgekehrt der Konflikt, könnte er auf die Erfahrung bauen, dass in Zeiten äußerer Gefahren fast jede Nation sich im Inneren um ihre Führer schart. Das nützt ihm dann auch. Kurz: Donald Trump kann in jedem Fall innenpolitisch profitieren und seine Widersacher bei den Demokraten vor erhebliche Probleme stellen.
Wenn man diesen – zugegeben vagen, sehr spekulativen und an dieser Stelle auch auf einen kontroversen Dialog zielenden – Vermutungen folgt, so bleibt aus unserer europäischer Sicht nur als unerfreuliches Fazit: Eine erfolgreiche Einflussnahme der EU auf die weitere Entwicklung rund um den Iran ist in den kommenden rund 9 Monaten extrem schwierig. Das bedeutet aber nicht, das Spielfeld zu verlassen und auf der Zuschauerbank Platz zu nehmen. Die nun vehement aufgeworfene Frage etwa, ob Soldaten der Bundeswehr weiterhin im Irak verbleiben sollen oder sofort abzuziehen sind, wirkt in diesem Zusammenhang aus sicherheitspolitischer Perspektive eher nachrangig. Aber das wäre ein eigenes Thema ...


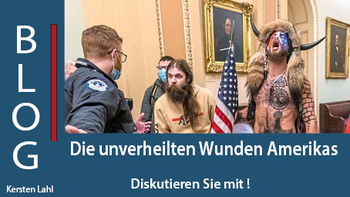






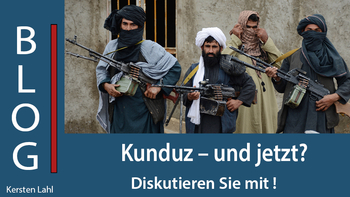

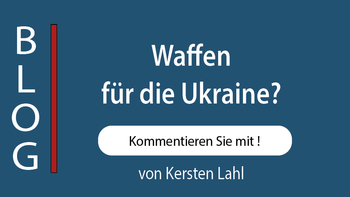
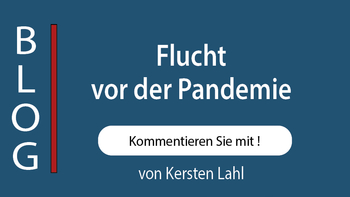
Kommentare (7)
Dennoch: Die Frage ist doch, wie und auf welchem Weg es gelingen kann, die iranische Führung von ihrem Handeln abzubringen. Und da steht meine These: So, wie Präsident Trump es nun offenbar versucht, wird das keinen Erfolg haben. Im Gegenteil. Der Gedanke, man könne autoritäre und verblendete Regime wie die des Iran mit immer wilderen Drohungen besänftigen und damit abschrecken, ist in der heutigen Zeit eher Wunschdenken. Das funktioniert wohl eher nicht, wie zahllose andere geschichtliche Beispiele belegen. Leider ist eine unkontrollierte Eskalation sehr viel wahrscheinlicher – mit ungewissen, aber umso schmerzhafteren Folgen für alle. Es bleibt ein Rätsel, warum Trump dieser Einsicht nicht folgen mag – und daher vermute ich eher eine innenpolitische Ratio hinter seinem Vorgehen. Anders kann ich mir das einfach nicht erklären.
Die Diplomatie hat mit dem Atomvertrag einen ersten richtigen Schritt gewagt: Kompromissfindung.
Doch ich bezweifle stark, dass ein Kompromiss gegenwärtig überhaupt mit den sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands oder Europas vereinbar ist, wenn es darum geht, die Aggression und den unbedingten Willen zur Expansion (u. a.) in der Region des schiitischen Halbmondes vonseiten des Iran zu verhindern.
Was hier erforderlich wäre, ist die rote Linie in unserem eigenen Interesse aufzuzeigen und uns selbst daran zu halten.
Anders als der ehemalige US-Präsident Obama in Syrien in der Vergangenheit, muss für uns gelten:
Die Expansion des Iran muss aufhören, die Förderung des Terrorismus (insbesondere mit Blick auf eine solche, die die israelische Souveränität bedroht) beendet werden und man muss auf eine Ergänzung eines etwaigen (Atom-)Abkommens bei Einbeziehung der benannten Kriterien hinarbeiten.
Gerade hier wäre es nun angesichts der aktuellen Corona-Krise im Iran zielführend, strategische Beziehungen aufzubauen und anti-westlichen Hardlinern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dahingegen beobachten wir hier gerade das Gegenteil: Die Politik des "maximalen Drucks" wird sogar noch verstärkt und neue Sanktionen gegen Iran inmitten der Covid-Pandemie auferlegt. Diese Politik spiegelt wieder, dass die aktuelle Administration nicht nur an Containment interessiert ist, sondern ein umfassendes Rollback der iranischen Machtposition anstrebt. Ob diese Strategie angesichts der angeschlagenen Lage Irans von Erfolg gekrönt sein wird, vermag ich nicht zu spekulieren.
Gemäß dem Fall, dass sie es jedoch nicht ist, gilt es zu bedenken, dass:
1. Chinas Einfluss im Iran gestärkt wird. China hat sich bereits im Zuge der früheren Sanktionen zu Irans wichtigsten Handelspartner entwickelt. Durch Chinas Appell an die USA und Weltgemeinschaft den Iran zu unterstützen, wirkt sich zudem positiv auf seine internationale Wahrnehmung als Norm-Enterpreneur und Gestalter ein neuen internationalen Ordnung aus. Dies wiederum stärkt die Führung in Peking auch hinsichtlich ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Kritik von Außen.
2. diese Politik den Ansichten und Voraussagen der iranischen Hardliner bestätigt. Obgleich die Proteste der vergangenen Monate bestätigen, dass das Regime zumindest schwankt, so ist der Einfluss der konservativen Kräfte nicht zu unterschätzen. Bereits die Bitte um internationale Unterstützung wird als Zeichen der Schwäche interpretiert, wobei die Abweisung dieser Hilfe (besonders seitens der USA), die anti-westliche Propaganda bestätigt.
3. Deutschland und die EU weiter an Einfluss und Glaubwürdigkeit in Iran verlieren. Europa selbst gilt spätestens seit der Aufkündigung des JCPOA durch die USA als blinder Gefolgsmann, obgleich die EU zur Nichteinhaltung der amerikanischen Sanktionen aufgerufen hat. Dieser Aufruf in Form von Instex ist gescheitert, die strukturelle Bedeutung der USA war zu stark. Nun wäre es sinnvoll, dass Europa mit starken Signalen an Iran vorangeht, um seinen Einfluss und Ruf im Land wiederherzustellen. Es waren die europäischen Staaten, die ursprünglich federführend bei den Verhandlungen zum Nuklearabkommen waren. Dies illustriert das enorme Potenzial globale Sicherheitspolitik auch ohne Gewalt, Herr Duman, zu gestalten. Nur sind die europäischen Staaten aktuell kaum in der Lage die eigene Gesundheitslage effektiv und solidarisch zu managen (sehen Sie hierzu auch den Blogeintrag zur Coronakrise).
Das erscheint mir auch so. Es ist erstaunlich, wie stark die wiederkehrenden Muster, u.a. der Iran-Konfrontation sind und die schon vor COVID.
Mit Trump gibt es allerdings einen Präsidenten, der die Konfrontation mit Iran stärker vorantreibt als jeder andere Präsident vor ihm. Gerade diese Persönlichkeit stellt unser Feld vor immer neuen diplomatischen und wissenschaftlichen Herausforderungen.